Versagt
Ich habe es verkackt. Es ist richtig schiefgelaufen. So fühlt es sich zumindest an. Mein Kopf, der alles gerne differenziert betrachtet, ruft schon wieder: „So kannst du das nicht sagen. Es war nicht alles schlecht.“ Es stimmt, es war kein komplettes Desaster, aber es war schon nahe dran.
Mit großer Freude hatte ich auf einen kleinen Lehrauftrag geschaut, genau dort, wo ich vor vier Jahren mein Sabbatical mit drei Weiterbildungen gestartet habe. Voller Stolz und in der Gewissheit, dass ich mich in die Lernenden einfühlen kann, weil ich auf der anderen Seite gesessen habe.
Und dann ist es einfach schiefgegangen. Ich habe die Ausgangssituation, in der die Teilnehmer stecken, falsch eingeschätzt. Ich habe sie überfordert mit zu viel Inhalt, zu schnellem Vorgehen und zu schweren Übungen. Und das haben sie mir klar zurückgemeldet. Wir hatten einen respektvollen Austausch auf Augenhöhe, aber es tut verdammt weh, 20 min. in verschiedenen Versionen zu hören, dass ich sie inhaltlich komplett verloren habe.
Ein tiefes Loch
Ich wertschätze die Offenheit und Klarheit, mit der mir die Rückmeldungen gegeben wurden. Es war mir also gelungen, eine Atmosphäre auf Augenhöhe und Vertrauen zu schaffen, in der die Teilnehmer ihren Frust so offen ansprechen konnten. Und doch war das Loch tief, nachdem die Videokonferenz beendet war. Ich habe versagt, auf ganzer Linie. Ich bin gescheitert.
Während ich im Loch saß, verurteilte ich mich, dass ich diesen Auftrag überhaupt angenommen habe. Ich war es ja selber schuld. Außerdem hätte ich es besser wissen müssen, da ich doch vor vier Jahren ebenfalls aus dem Job heraus in eine Weiterbildung gegangen bin und von einem Tag auf den anderen acht Stunden zuhören, mitmachen und lernen musste. Mein innerer Kritiker drehte eine fröhliche Runde und drosch gemeinsam mit Schuldgefühlen und Scham auf mich ein. Wie konnte mir das passieren?
Abstand
Mit etwas Abstand, nach einem Radler im Biergarten und einer überschlafenen Nacht, sah die Welt schon anders aus. Das Gefühl, gescheitert zu sein, war noch da. Aber es hatte sich verändert. Vielleicht war es noch keine echte „jetzt erst recht“-Stimmung. Es fühlte sich eher an wie eine Mischung aus Scham „oh mein Gott, ich habe versagt“ und Demut, dass ich an eine Grenze gekommen bin, die ich nicht gesehen hatte. Ja, ich darf lernen. Jeden Tag. Und so fühlte sich die Rückmeldung am nächsten Tag an. Da war auch Dankbarkeit, dass die Teilnehmer so offen gesprochen hatten. Sie haben mir vertraut und ihren Frust bei mir herausgelassen. Nicht alles, was angesprochen wurde, hatte mit mir und meinem verkackten Tag zu tun. Aber an dem Tag war so viel hinzugekommen, dass sie laut die Hand hoben und um Hilfe gebeten haben.
Neuer Blickwinkel
Mein erster Gedanke „Ich schmeiße das alles hin. Ist sowieso nur unglaublich viel Arbeit, die on-top zu allem anderen kommt.“ war zum Glück verflogen. Und stattdessen spürte ich eine Kraft und Gewissheit: Ich kann das besser. Und ich möchte die Teilnehmer dort abholen, wo sie stehen, um sie auf ihrem Lernweg zu begleiten. Sie fordern, aber nicht überfordern. Damit ich das schaffe, muss ich aber wieder aufstehen. Ich darf nicht in meinem Loch verbleiben.
In dem Loch lauert das Selbstmitleid, das nichts bringt außer Leid. Ich drehe mich um mich selber und versinke immer tiefer im Selbstmitleid. Ebenso wartet dort die Opferrolle auf mich. „Das hätten die mir doch besser erklären müssen. Warum lassen die mich damit auch so alleine?“ Auch in der Rolle als Opfer komme ich kein Stück nach vorne. Mit Gedanken wie „die Welt ist so ungerecht zu mir.“ oder „warum muss so etwas immer mir passieren?“ bleibe ich im Selbstmitleid und versuche der Welt im Außen die Schuld rüber zu schieben. Und mein innerer Kritiker wartet in dem Loch auf mich, um das zu tun, was er am liebsten macht: mir meine alten Glaubenssätze um die Ohren zu hauen und vorzugeben, das wäre wahr.
Wie der Weg weitergeht
Ich kenne dieses Loch ganz gut. Schon oft bin ich dort gelandet, habe mich dort eingerichtet und mit mir und der Welt gehadert. Und was hat es mir gebracht? Nichts! Nur, wenn ich wieder aufstehe, meinen Kopf hebe und nach vorne schaue, kann ich erkennen, wie mein Weg weiter geht.
Mit den Worten meines inneren Kritikers in den Ohren und den Kratzern an meinem Ego ist es gar nicht so einfach, zurück in die Spur zu kommen. Aber die Erkenntnis „ich kann das besser“, ist der Leuchtturm, der mir die Richtung weist. Ich weiß nicht, ob ich die vier Tage Unterricht nächste Woche hinbekomme. Ich kann nicht sicher sein, dass ich es so hinbekomme, wie ich es mir vorstelle und wie es für die Teilnehmer passt. Aber ich weiß, dass ich es besser machen kann. Ich kann daraus lernen und neu ansetzen. Und ich kann um Hilfe bitten, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Drei Möglichkeiten
Gerade den letzten Punkt vergesse ich immer wieder. In mir wohnt noch immer die kleine Anne, die alles alleine schaffen möchte. Aber das muss ich nicht. Ich darf um Hilfe bitten. Und die Person, die ich um Hilfe bitte, hat immer drei Möglichkeiten:
- Sie kann ja sagen und mir helfen.
- Sie kann sagen, „ja ich helfe, dir aber nicht jetzt, sondern wenn ich Zeit habe.“
- Oder sie kann „nein“ sagen.
Niemand muss jemand anderem helfen. Die meisten Menschen freuen sich jedoch, wenn sie um Hilfe gebeten werden. So habe ich es bei mir selber und bei Menschen, die ich um Hilfe gebeten habe, schon oft erlebt. Und wenn jemand nein sagt, hat das nichts mit mir, sondern nur etwas mit der Person zu tun. Manchmal hat mein Gegenüber einfach keine Zeit, keine Lust oder den Fokus auf anderen Themen. Und wenn ich die Option, dass der oder die andere natürlich auch nein sagen kann, im Kopf habe, kommt auch keine Enttäuschung.
Wofür es gut ist
Wie gehst du damit um, wenn du scheiterst? Wie gelingt es dir, wieder aufzustehen?
Für mich ist es wahrscheinlich sehr gut, dass ich in der aktuellen Situation nicht kneifen kann. Natürlich könnte ich hinschmeißen, aber dann würde ich die Kollegen hängenlassen. Und das wäre für mich noch schlimmer, als wenn es wieder schiefgeht. Mit der Überzeugung, dass ich es schon irgendwie schaffen werde, schaue ich auf die Tage, die vor mir liegen. Ich kann noch am Konzept und den Inhalten feilen. Ich kann es mit Kolleg:innen durchsprechen und mir deren Rat und Hilfe einholen. Und in zwei Wochen bin ich sehr viel schlauer.
Vielleicht ist es wirklich nichts für mich. Dann habe ich das gelernt. Doch vielleicht – und das hoffe ich – bekomme ich es mit den Erfahrungen des verpatzten ersten Tages hin, die Teilnehmer mitzunehmen. Dann habe ich wirklich viel gelernt. Und genau das ist das, „wofür es gut ist“.
Vielleicht kennst du diesen Satz, wenn du scheiterst oder wenn etwas schiefgeht: „Wer weiß, wofür es gut ist.“ Es ist genau für das gut, was ich daraus mache. Ich nehme für mich mit, …
… dass ich nicht so schnell aufgebe,
… dass ich nicht alles alleine schaffen muss und
… dass ich den Mut habe, vielleicht erneut zu scheitern.
Und in zwei Wochen nehme ich vielleicht noch etwas ganz anderes mit, was ich heute noch gar nicht ahnen kann. Nur eines weiß ich sicher, ich bin gescheitert, um wieder aufzustehen.
Wann bist du zuletzt gescheitert?
Was hast du daraus gemacht?
Bildnachweis für diesen Beitrag: Welle, Wasser, Meer © 4311868 (pixabay CC-0)
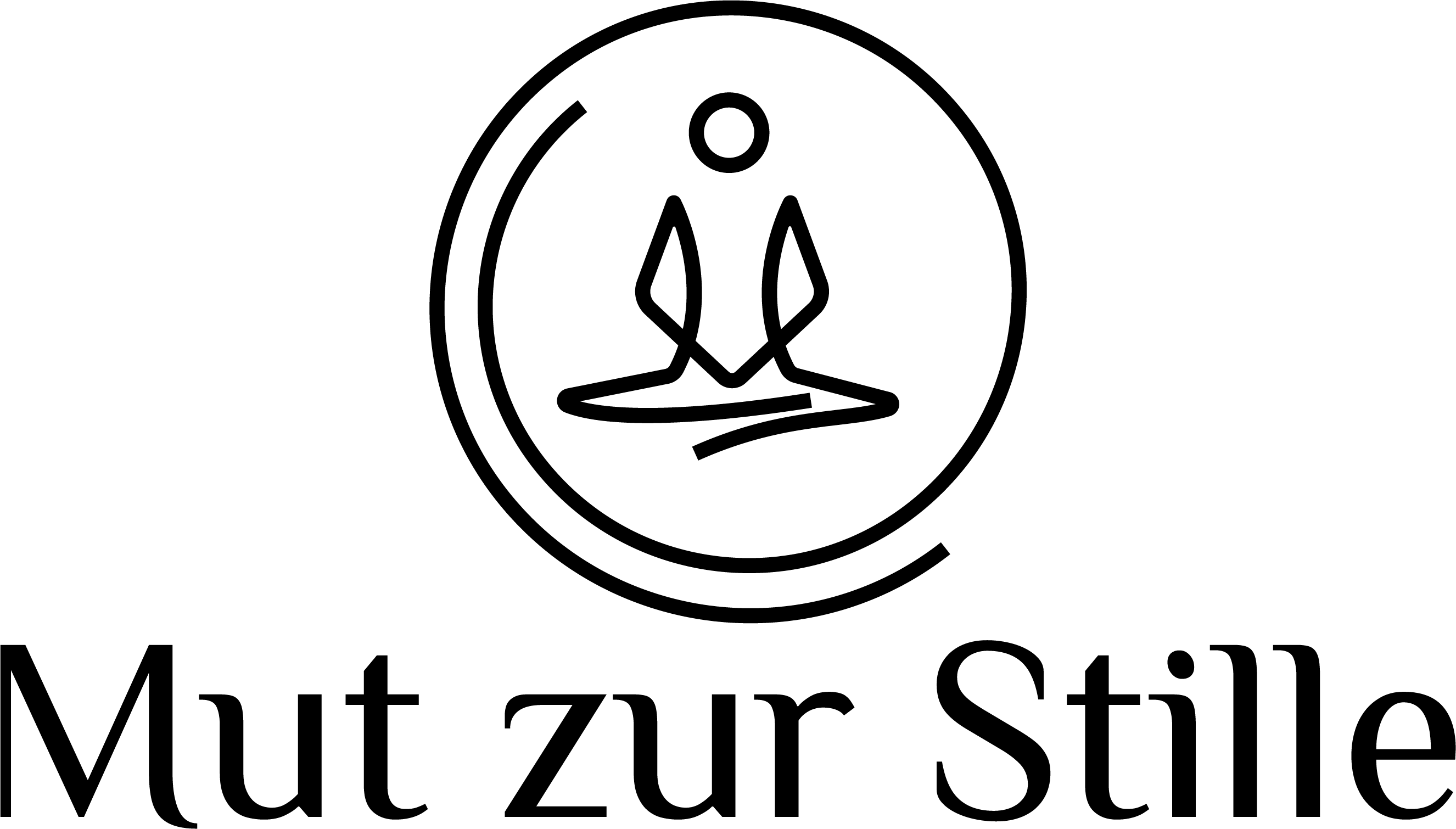

Pingback:Bin ich ein guter Mensch? - Mut zur Stille